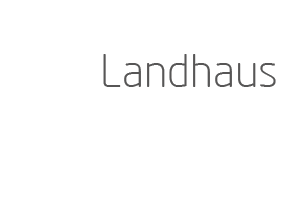Das Bayerische Reinheitsgebot
Es war am Georgi-Tag, am 23. April 1516: Auf dem Bayerischen Landstädtetag zu Ingolstadt unterzeichnete Wilhelm IV., Herzog von Bayern, den Erlass, „dass forthin allenthalben in unseren Städten, Märkten und auf dem Lande zu keinem Bier mehr Stücke als allein Gersten, Hopfen und Wasser verwendet und gebraucht werden sollen.“.
Damit hat er das älteste Lebensmittelgesetz der Welt installiert, das seither unter dem Begriff „Reinheitsgebot“ bekannt ist.
Damit hat er das älteste Lebensmittelgesetz der Welt installiert, das seither unter dem Begriff „Reinheitsgebot“ bekannt ist.
Vor 500 Jahren ging es dabei weniger um die Qualität des Gerstensaftes. Ziel war es zunächst, Brotgetreide wie Roggen zu schützen und infolgedessen Hungersnöte zu verhindern. Und mit Weizen brauen durfte nur, wer sich die entsprechende Genehmigung teuer erkauft hatte.
Ferngehalten werden sollten die Untertanen zudem von berauschenden Zutaten wie Schlafmohn; stattdessen setzte man auf beruhigenden Hopfen.
Die Hefe war zunächst nicht bekannt und ist seinerzeit deshalb auch nicht benannt, wurde aber von Sud zu Sud weiterverwendet. Gelangten dabei falsche Hefestämme ins Bier, waren Hopfen und Malz verloren.
Die Hefe war zunächst nicht bekannt und ist seinerzeit deshalb auch nicht benannt, wurde aber von Sud zu Sud weiterverwendet. Gelangten dabei falsche Hefestämme ins Bier, waren Hopfen und Malz verloren.
Heute stehen den Brauern mehr als 40 verschiedene Malze, rund 180 Hopfensorten und etwa 200 Hefestämme zur Verfügung. So ist es auch zu erklären, dass hierzulande geschätzte 5.500 verschiedene Biere aus vier natürlichen Rohstoffen gebraut werden. Allein das ist schon ein Grund zum Feiern!